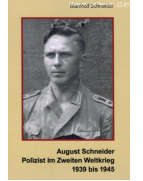

Neuerscheinung
Polizeigeschichte im Zweiten Weltkrieg: Kriegsverbrechen und Verleugnung
Der Vater im „Bandenkampf“, der Sohn auf seinen Spuren
Der Autor des Buches, Manfred Schneider, geboren 1948 in der Oberpfalz, gehört zur Nachkriegsgeneration, die zwar nicht mehr das Unrechtsregime des Dritten Reiches und die Entbehrungen und Schrecken eines totalen Krieges miterleben musste, die aber mit den materiellen
Unrechtsregime des Dritten Reiches und die Entbehrungen und Schrecken eines totalen Krieges miterleben musste, die aber mit den materiellen und seelischen Nachwirkungen dieser Katastrophen konfrontiert wurde. Der Vater des Autors, der 1917 geborene August Schneider, stammte
und seelischen Nachwirkungen dieser Katastrophen konfrontiert wurde. Der Vater des Autors, der 1917 geborene August Schneider, stammte aus dem saarländischen Quierschied und trat 1935 in Köln der preußischen Landespolizei bei. Nach der „Machtübernahme“ der
aus dem saarländischen Quierschied und trat 1935 in Köln der preußischen Landespolizei bei. Nach der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten gehörte er knapp zwei Jahre lang der Hitlerjugend (HJ) an, später auch der NSV, dem Reichskolonialbund und dem Volksbund
Nationalsozialisten gehörte er knapp zwei Jahre lang der Hitlerjugend (HJ) an, später auch der NSV, dem Reichskolonialbund und dem Volksbund für das Deutschtum im Ausland. Er wurde aber weder Mitglied der NSDAP noch der SA oder SS.
für das Deutschtum im Ausland. Er wurde aber weder Mitglied der NSDAP noch der SA oder SS. 1938 nahm August Schneider als Polizeiangehöriger am deutschen „Einmarsch“ in Österreich teil, im folgenden Jahr an der Besetzung des
1938 nahm August Schneider als Polizeiangehöriger am deutschen „Einmarsch“ in Österreich teil, im folgenden Jahr an der Besetzung des Sudetenlandes und nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen Anfang September 1939 am Aufbau und der Ausübung der Besatzungs- und
Sudetenlandes und nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen Anfang September 1939 am Aufbau und der Ausübung der Besatzungs- und Polizeiverwaltung in Posen. 1941 wurde er zur Schutzpolizeischule Gnesen versetzt, wo er als Unterführer in der Polizeiausbildung tätig war,
Polizeiverwaltung in Posen. 1941 wurde er zur Schutzpolizeischule Gnesen versetzt, wo er als Unterführer in der Polizeiausbildung tätig war, auch über den Beginn des Russland-Feldzugs hinaus.Im Juni 1943 wurde August Schneider dann dem Polizei-Schützen-Regiment 35 zugeteilt, das
auch über den Beginn des Russland-Feldzugs hinaus.Im Juni 1943 wurde August Schneider dann dem Polizei-Schützen-Regiment 35 zugeteilt, das in der Ukraine bei der so genannten „Bandenbekämpfung“, also in dem brutalen Kampf gegen Partisanen, zum Einsatz kam. Standort der Einheit
in der Ukraine bei der so genannten „Bandenbekämpfung“, also in dem brutalen Kampf gegen Partisanen, zum Einsatz kam. Standort der Einheit war Litzmannstadt (Lodz), wo die SS ein großes jüdisches Getto errichtet hatte. Nach Kämpfen und starken Verlusten wurde das Regiment im
war Litzmannstadt (Lodz), wo die SS ein großes jüdisches Getto errichtet hatte. Nach Kämpfen und starken Verlusten wurde das Regiment im April 1944 mit den Resten des ebenfalls dezimierten SS-Polizei-Regiments 10 zusammengelegt und in das Adriatische Küstenland Sloweniens
April 1944 mit den Resten des ebenfalls dezimierten SS-Polizei-Regiments 10 zusammengelegt und in das Adriatische Küstenland Sloweniens verlegt. Auch hier galt der Einsatz der Vernichtung der Partisanen, aber die Deutschen verloren immer mehr an Boden, und August Schneider
verlegt. Auch hier galt der Einsatz der Vernichtung der Partisanen, aber die Deutschen verloren immer mehr an Boden, und August Schneider kam im Mai 1945 in Kärnten in amerikanische Gefangenschaft. Bereits nach sechs Wochen Internierung in Flossenbürg und Weiden in der
kam im Mai 1945 in Kärnten in amerikanische Gefangenschaft. Bereits nach sechs Wochen Internierung in Flossenbürg und Weiden in der Oberpfalz wurde er entlassen und als Hilfspolizist in die bayerische Landespolizei übernommen. 1950 wechselte er zur saarländischen Polizei und
Oberpfalz wurde er entlassen und als Hilfspolizist in die bayerische Landespolizei übernommen. 1950 wechselte er zur saarländischen Polizei und trat 1977 in den Ruhestand.
trat 1977 in den Ruhestand. Manfred Schneider, der Sohn des Polizisten, wuchs im Saarland auf, das ab 1957 wieder zu Deutschland, zur Bundesrepublik, gehörte. Nach
Manfred Schneider, der Sohn des Polizisten, wuchs im Saarland auf, das ab 1957 wieder zu Deutschland, zur Bundesrepublik, gehörte. Nach Volksschule und abgebrochener Gymnasialbildung absolvierte er erfolgreich eine Lehre als Autoschlosser, jedoch verfolgte er die restaurative
Volksschule und abgebrochener Gymnasialbildung absolvierte er erfolgreich eine Lehre als Autoschlosser, jedoch verfolgte er die restaurative gesellschaftliche Entwicklung im Land mit Skepsis. 1967 zog er nach Ulm und Ende 1969 nach Berlin, um der Einberufung zur Bundeswehr zu
gesellschaftliche Entwicklung im Land mit Skepsis. 1967 zog er nach Ulm und Ende 1969 nach Berlin, um der Einberufung zur Bundeswehr zu entgehen. Als Arbeiter in den rebellischen studentischen Kreisen bisweilen hofiert, stand er in Opposition zu den autoritären Tendenzen des
entgehen. Als Arbeiter in den rebellischen studentischen Kreisen bisweilen hofiert, stand er in Opposition zu den autoritären Tendenzen des Staates. Schon der Eichmann-Prozess 1961 in Israel hatte ihn beeindruckt, die „Spiegel“-Affäre 1962 bestätigte ihn in seiner kritischen Haltung,
Staates. Schon der Eichmann-Prozess 1961 in Israel hatte ihn beeindruckt, die „Spiegel“-Affäre 1962 bestätigte ihn in seiner kritischen Haltung, noch mehr der Auswitz-Prozess von 1963 bis 1965. Der Vietnam-Krieg der Amerikaner, bei dem die „guten Befreier“ mehr und mehr im Morast
noch mehr der Auswitz-Prozess von 1963 bis 1965. Der Vietnam-Krieg der Amerikaner, bei dem die „guten Befreier“ mehr und mehr im Morast eines unerklärten, brutalen Krieges versanken, weckte bei Manfred Schneider zunehmend Assoziationen zu den mittlerweile bekannten
eines unerklärten, brutalen Krieges versanken, weckte bei Manfred Schneider zunehmend Assoziationen zu den mittlerweile bekannten Massenverbrechen der deutschen Wehrmacht und Polizei im Zweiten Weltkrieg in Polen und der Sowjetunion. War auch sein Vater an solchen
Massenverbrechen der deutschen Wehrmacht und Polizei im Zweiten Weltkrieg in Polen und der Sowjetunion. War auch sein Vater an solchen Verbrechen beteiligt gewesen?
Verbrechen beteiligt gewesen?  Der hatte kaum jemals von sich aus über seine Erlebnisse im Krieg erzählt. Und der Sohn, so gestand dieser sich später selbst ein, hat auch nie
Der hatte kaum jemals von sich aus über seine Erlebnisse im Krieg erzählt. Und der Sohn, so gestand dieser sich später selbst ein, hat auch nie hartnäckig nachgefragt. Im Jahr 1968 gab es viele Diskussionen zwischen Vater und Sohn „über das, was war und was sein sollte“. „Vor dem
hartnäckig nachgefragt. Im Jahr 1968 gab es viele Diskussionen zwischen Vater und Sohn „über das, was war und was sein sollte“. „Vor dem Hintergrund dieses Zeitgeistes fanden unsere Auseinandersetzungen statt. … Mitten in diesem Aufbruch der Generationen, streikend für
Hintergrund dieses Zeitgeistes fanden unsere Auseinandersetzungen statt. … Mitten in diesem Aufbruch der Generationen, streikend für kollektive Lernformen und die Weltverbesserung, wusste ich die Welt besser zu erklären als mein Vater. Ich machte ihn für alles aus dem Dritten
kollektive Lernformen und die Weltverbesserung, wusste ich die Welt besser zu erklären als mein Vater. Ich machte ihn für alles aus dem Dritten Reich übrig Gebliebene verantwortlich. Aber auch er kämpfte, ging keinem Streit aus dem Weg, und im Nachhinein weiß ich, wie oft und tief ich
Reich übrig Gebliebene verantwortlich. Aber auch er kämpfte, ging keinem Streit aus dem Weg, und im Nachhinein weiß ich, wie oft und tief ich ihn getroffen habe, wie sehr er leiden musste ob der Uneinsichtigkeit und Unbarmherzigkeit seines Sohnes.“ Trotz aller
ihn getroffen habe, wie sehr er leiden musste ob der Uneinsichtigkeit und Unbarmherzigkeit seines Sohnes.“ Trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen kam es nicht zum völligen Bruch zwischen Vater und Sohn. Mit den Jahren näherten sie
Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen kam es nicht zum völligen Bruch zwischen Vater und Sohn. Mit den Jahren näherten sie sich wieder an, und 1991 besuchten sie gemeinsam die polnischen Städte Posen und Gnesen, wo August Schneider während des Krieges
sich wieder an, und 1991 besuchten sie gemeinsam die polnischen Städte Posen und Gnesen, wo August Schneider während des Krieges Polizeidienst verrichtet hatte. Ein Jahr später verstarb der Vater in Rötz in der Oberpfalz, wo er nach der Ruhestandsversetzung mit seiner
Polizeidienst verrichtet hatte. Ein Jahr später verstarb der Vater in Rötz in der Oberpfalz, wo er nach der Ruhestandsversetzung mit seiner Ehefrau gelebt hatte.
Für den Sohn war der Tod des Vaters nun aber nicht etwa der Schlusspunkt der Diskussionen, sondern vielmehr Ausgangspunkt umfangreicher
Ehefrau gelebt hatte.
Für den Sohn war der Tod des Vaters nun aber nicht etwa der Schlusspunkt der Diskussionen, sondern vielmehr Ausgangspunkt umfangreicher Recherchen zum dienstlichen Leben des Vaters während des Krieges. Er suchte zahlreiche Archive in Deutschland, Polen und Slowenien auf: „Es
Recherchen zum dienstlichen Leben des Vaters während des Krieges. Er suchte zahlreiche Archive in Deutschland, Polen und Slowenien auf: „Es war wie kriminalistische Kleinarbeit, die mich von Archiv zu Archiv, von Hinweis zu Hinweis, zu Kombinationen in eine Welt führte, über der ein
war wie kriminalistische Kleinarbeit, die mich von Archiv zu Archiv, von Hinweis zu Hinweis, zu Kombinationen in eine Welt führte, über der ein bleierner Mantel des Schweigens, des Rechtfertigens und der Scham lag.“ Er hatte zwar keinen konkreten Verdacht, aber doch die Befürchtung,
bleierner Mantel des Schweigens, des Rechtfertigens und der Scham lag.“ Er hatte zwar keinen konkreten Verdacht, aber doch die Befürchtung, dass der Vater an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein könnte. Denn dieser war ja an Orten gewesen, an denen Polizeieinheiten
dass der Vater an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein könnte. Denn dieser war ja an Orten gewesen, an denen Polizeieinheiten systematisch Massenverbrechen begangen hatten, in Polen, in der Ukraine, in Jugoslawien. „Er hat gesehen, was geschah, und er wusste, dass es
systematisch Massenverbrechen begangen hatten, in Polen, in der Ukraine, in Jugoslawien. „Er hat gesehen, was geschah, und er wusste, dass es falsch war.“
Die Ergebnisse der Recherchen Manfred Schneiders sollen hier nicht vorweggenommen werden. Abschließend schreibt der Autor in dem sehr
falsch war.“
Die Ergebnisse der Recherchen Manfred Schneiders sollen hier nicht vorweggenommen werden. Abschließend schreibt der Autor in dem sehr lesenswerten Buch: „Ich habe mich nicht bemüht, allgemeinverbindlich objektiv zu sein. Ich habe das, was ich fand, nach meiner
lesenswerten Buch: „Ich habe mich nicht bemüht, allgemeinverbindlich objektiv zu sein. Ich habe das, was ich fand, nach meiner Lebenserfahrung, nach meiner Durchdringung vor meinem Hintergrund, meiner Bildung verarbeitet und bewertet. … Ich glaube, wir müssen
Lebenserfahrung, nach meiner Durchdringung vor meinem Hintergrund, meiner Bildung verarbeitet und bewertet. … Ich glaube, wir müssen unseren Kindern sagen, wer wir sind und woher wir kommen.“
unseren Kindern sagen, wer wir sind und woher wir kommen.“ Manfred Schneider
August Schneider. Polizist im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945
Berlin 2021
Paperback
398 Seiten
19,26 Euro
ISBN 979-8-7001-7186-1
Über den Autor
Manfred Schneider
August Schneider. Polizist im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945
Berlin 2021
Paperback
398 Seiten
19,26 Euro
ISBN 979-8-7001-7186-1
Über den Autor Manfred Schneider wurde 1948 in Rötz /Opf. in Bayern geboren und wuchs ab 1950 im Saarland auf. Er erlernte in Lebach (Landkreis
Manfred Schneider wurde 1948 in Rötz /Opf. in Bayern geboren und wuchs ab 1950 im Saarland auf. Er erlernte in Lebach (Landkreis  Saarlouis) den Beruf des Autoschlossers, studierte von 1971 bis 1974 Sozialarbeit in Berlin und war in der Zeit von 1974 bis 1985 in der
Saarlouis) den Beruf des Autoschlossers, studierte von 1971 bis 1974 Sozialarbeit in Berlin und war in der Zeit von 1974 bis 1985 in der Planungsgruppe der Berliner Senatsverwaltung für Familie, Jugend und Sport tätig. 1985 machte er sich selbstständig und gründete mit
Planungsgruppe der Berliner Senatsverwaltung für Familie, Jugend und Sport tätig. 1985 machte er sich selbstständig und gründete mit anderen ein Beratungsunternehmen für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in dem er immer noch aktiv ist, auch nach seinem Eintritt in den
anderen ein Beratungsunternehmen für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in dem er immer noch aktiv ist, auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand.
Als heranwachsender Jugendlicher hat ihn mehr und mehr die Frage bewegt, welche Rolle sein Vater, der während des Zweiten Weltkrieges als
Ruhestand.
Als heranwachsender Jugendlicher hat ihn mehr und mehr die Frage bewegt, welche Rolle sein Vater, der während des Zweiten Weltkrieges als Polizist an verschiedenen Schauplätzen eingesetzt war, tatsächlich gespielt hat. Tat er dort seinen Dienst nur als Ordnungspolizist oder hatte
Polizist an verschiedenen Schauplätzen eingesetzt war, tatsächlich gespielt hat. Tat er dort seinen Dienst nur als Ordnungspolizist oder hatte er weiterreichende Aufgaben? War er gar an Kriegsverbrechen beteiligt? Antworten auf solche Fragen bekam er von seinem Vater nicht. Der
er weiterreichende Aufgaben? War er gar an Kriegsverbrechen beteiligt? Antworten auf solche Fragen bekam er von seinem Vater nicht. Der aber war dort, wo von der Polizei systematisch Gräueltaten verübt worden waren, nämlich in Polen, in der Ukraine und in Jugoslawien. Es war
aber war dort, wo von der Polizei systematisch Gräueltaten verübt worden waren, nämlich in Polen, in der Ukraine und in Jugoslawien. Es war damals die Zeit, über der ein bleierner Mantel des Schweigens, Verdrängens, Rechtfertigens und der Scham lag. Manfred Schneider wollte
damals die Zeit, über der ein bleierner Mantel des Schweigens, Verdrängens, Rechtfertigens und der Scham lag. Manfred Schneider wollte sich damit nicht zufrieden geben. So begann für ihn – neben seiner Berufstätigkeit – eine lange Zeit des Suchens und Nachforschens.
sich damit nicht zufrieden geben. So begann für ihn – neben seiner Berufstätigkeit – eine lange Zeit des Suchens und Nachforschens. Diesem Buch liegt eine jahrzehntelange akribische Recherche in nationalen und internationalen Archiven zugrunde, während derer der
Diesem Buch liegt eine jahrzehntelange akribische Recherche in nationalen und internationalen Archiven zugrunde, während derer der  Autor eine Vielzahl von Originaldokumenten ausfindig machen, sichten und auswerten konnte. Bei seinen Sucharbeiten fand er in den
Autor eine Vielzahl von Originaldokumenten ausfindig machen, sichten und auswerten konnte. Bei seinen Sucharbeiten fand er in den jeweiligen ArchivInstitutionen wertvolle Hilfestellungen
jeweiligen ArchivInstitutionen wertvolle Hilfestellungen
 Unrechtsregime des Dritten Reiches und die Entbehrungen und Schrecken eines totalen Krieges miterleben musste, die aber mit den materiellen
Unrechtsregime des Dritten Reiches und die Entbehrungen und Schrecken eines totalen Krieges miterleben musste, die aber mit den materiellen und seelischen Nachwirkungen dieser Katastrophen konfrontiert wurde. Der Vater des Autors, der 1917 geborene August Schneider, stammte
und seelischen Nachwirkungen dieser Katastrophen konfrontiert wurde. Der Vater des Autors, der 1917 geborene August Schneider, stammte aus dem saarländischen Quierschied und trat 1935 in Köln der preußischen Landespolizei bei. Nach der „Machtübernahme“ der
aus dem saarländischen Quierschied und trat 1935 in Köln der preußischen Landespolizei bei. Nach der „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten gehörte er knapp zwei Jahre lang der Hitlerjugend (HJ) an, später auch der NSV, dem Reichskolonialbund und dem Volksbund
Nationalsozialisten gehörte er knapp zwei Jahre lang der Hitlerjugend (HJ) an, später auch der NSV, dem Reichskolonialbund und dem Volksbund für das Deutschtum im Ausland. Er wurde aber weder Mitglied der NSDAP noch der SA oder SS.
für das Deutschtum im Ausland. Er wurde aber weder Mitglied der NSDAP noch der SA oder SS. 1938 nahm August Schneider als Polizeiangehöriger am deutschen „Einmarsch“ in Österreich teil, im folgenden Jahr an der Besetzung des
1938 nahm August Schneider als Polizeiangehöriger am deutschen „Einmarsch“ in Österreich teil, im folgenden Jahr an der Besetzung des Sudetenlandes und nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen Anfang September 1939 am Aufbau und der Ausübung der Besatzungs- und
Sudetenlandes und nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen Anfang September 1939 am Aufbau und der Ausübung der Besatzungs- und Polizeiverwaltung in Posen. 1941 wurde er zur Schutzpolizeischule Gnesen versetzt, wo er als Unterführer in der Polizeiausbildung tätig war,
Polizeiverwaltung in Posen. 1941 wurde er zur Schutzpolizeischule Gnesen versetzt, wo er als Unterführer in der Polizeiausbildung tätig war, auch über den Beginn des Russland-Feldzugs hinaus.Im Juni 1943 wurde August Schneider dann dem Polizei-Schützen-Regiment 35 zugeteilt, das
auch über den Beginn des Russland-Feldzugs hinaus.Im Juni 1943 wurde August Schneider dann dem Polizei-Schützen-Regiment 35 zugeteilt, das in der Ukraine bei der so genannten „Bandenbekämpfung“, also in dem brutalen Kampf gegen Partisanen, zum Einsatz kam. Standort der Einheit
in der Ukraine bei der so genannten „Bandenbekämpfung“, also in dem brutalen Kampf gegen Partisanen, zum Einsatz kam. Standort der Einheit war Litzmannstadt (Lodz), wo die SS ein großes jüdisches Getto errichtet hatte. Nach Kämpfen und starken Verlusten wurde das Regiment im
war Litzmannstadt (Lodz), wo die SS ein großes jüdisches Getto errichtet hatte. Nach Kämpfen und starken Verlusten wurde das Regiment im April 1944 mit den Resten des ebenfalls dezimierten SS-Polizei-Regiments 10 zusammengelegt und in das Adriatische Küstenland Sloweniens
April 1944 mit den Resten des ebenfalls dezimierten SS-Polizei-Regiments 10 zusammengelegt und in das Adriatische Küstenland Sloweniens verlegt. Auch hier galt der Einsatz der Vernichtung der Partisanen, aber die Deutschen verloren immer mehr an Boden, und August Schneider
verlegt. Auch hier galt der Einsatz der Vernichtung der Partisanen, aber die Deutschen verloren immer mehr an Boden, und August Schneider kam im Mai 1945 in Kärnten in amerikanische Gefangenschaft. Bereits nach sechs Wochen Internierung in Flossenbürg und Weiden in der
kam im Mai 1945 in Kärnten in amerikanische Gefangenschaft. Bereits nach sechs Wochen Internierung in Flossenbürg und Weiden in der Oberpfalz wurde er entlassen und als Hilfspolizist in die bayerische Landespolizei übernommen. 1950 wechselte er zur saarländischen Polizei und
Oberpfalz wurde er entlassen und als Hilfspolizist in die bayerische Landespolizei übernommen. 1950 wechselte er zur saarländischen Polizei und trat 1977 in den Ruhestand.
trat 1977 in den Ruhestand. Manfred Schneider, der Sohn des Polizisten, wuchs im Saarland auf, das ab 1957 wieder zu Deutschland, zur Bundesrepublik, gehörte. Nach
Manfred Schneider, der Sohn des Polizisten, wuchs im Saarland auf, das ab 1957 wieder zu Deutschland, zur Bundesrepublik, gehörte. Nach Volksschule und abgebrochener Gymnasialbildung absolvierte er erfolgreich eine Lehre als Autoschlosser, jedoch verfolgte er die restaurative
Volksschule und abgebrochener Gymnasialbildung absolvierte er erfolgreich eine Lehre als Autoschlosser, jedoch verfolgte er die restaurative gesellschaftliche Entwicklung im Land mit Skepsis. 1967 zog er nach Ulm und Ende 1969 nach Berlin, um der Einberufung zur Bundeswehr zu
gesellschaftliche Entwicklung im Land mit Skepsis. 1967 zog er nach Ulm und Ende 1969 nach Berlin, um der Einberufung zur Bundeswehr zu entgehen. Als Arbeiter in den rebellischen studentischen Kreisen bisweilen hofiert, stand er in Opposition zu den autoritären Tendenzen des
entgehen. Als Arbeiter in den rebellischen studentischen Kreisen bisweilen hofiert, stand er in Opposition zu den autoritären Tendenzen des Staates. Schon der Eichmann-Prozess 1961 in Israel hatte ihn beeindruckt, die „Spiegel“-Affäre 1962 bestätigte ihn in seiner kritischen Haltung,
Staates. Schon der Eichmann-Prozess 1961 in Israel hatte ihn beeindruckt, die „Spiegel“-Affäre 1962 bestätigte ihn in seiner kritischen Haltung, noch mehr der Auswitz-Prozess von 1963 bis 1965. Der Vietnam-Krieg der Amerikaner, bei dem die „guten Befreier“ mehr und mehr im Morast
noch mehr der Auswitz-Prozess von 1963 bis 1965. Der Vietnam-Krieg der Amerikaner, bei dem die „guten Befreier“ mehr und mehr im Morast eines unerklärten, brutalen Krieges versanken, weckte bei Manfred Schneider zunehmend Assoziationen zu den mittlerweile bekannten
eines unerklärten, brutalen Krieges versanken, weckte bei Manfred Schneider zunehmend Assoziationen zu den mittlerweile bekannten Massenverbrechen der deutschen Wehrmacht und Polizei im Zweiten Weltkrieg in Polen und der Sowjetunion. War auch sein Vater an solchen
Massenverbrechen der deutschen Wehrmacht und Polizei im Zweiten Weltkrieg in Polen und der Sowjetunion. War auch sein Vater an solchen Verbrechen beteiligt gewesen?
Verbrechen beteiligt gewesen?  Der hatte kaum jemals von sich aus über seine Erlebnisse im Krieg erzählt. Und der Sohn, so gestand dieser sich später selbst ein, hat auch nie
Der hatte kaum jemals von sich aus über seine Erlebnisse im Krieg erzählt. Und der Sohn, so gestand dieser sich später selbst ein, hat auch nie hartnäckig nachgefragt. Im Jahr 1968 gab es viele Diskussionen zwischen Vater und Sohn „über das, was war und was sein sollte“. „Vor dem
hartnäckig nachgefragt. Im Jahr 1968 gab es viele Diskussionen zwischen Vater und Sohn „über das, was war und was sein sollte“. „Vor dem Hintergrund dieses Zeitgeistes fanden unsere Auseinandersetzungen statt. … Mitten in diesem Aufbruch der Generationen, streikend für
Hintergrund dieses Zeitgeistes fanden unsere Auseinandersetzungen statt. … Mitten in diesem Aufbruch der Generationen, streikend für kollektive Lernformen und die Weltverbesserung, wusste ich die Welt besser zu erklären als mein Vater. Ich machte ihn für alles aus dem Dritten
kollektive Lernformen und die Weltverbesserung, wusste ich die Welt besser zu erklären als mein Vater. Ich machte ihn für alles aus dem Dritten Reich übrig Gebliebene verantwortlich. Aber auch er kämpfte, ging keinem Streit aus dem Weg, und im Nachhinein weiß ich, wie oft und tief ich
Reich übrig Gebliebene verantwortlich. Aber auch er kämpfte, ging keinem Streit aus dem Weg, und im Nachhinein weiß ich, wie oft und tief ich ihn getroffen habe, wie sehr er leiden musste ob der Uneinsichtigkeit und Unbarmherzigkeit seines Sohnes.“ Trotz aller
ihn getroffen habe, wie sehr er leiden musste ob der Uneinsichtigkeit und Unbarmherzigkeit seines Sohnes.“ Trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen kam es nicht zum völligen Bruch zwischen Vater und Sohn. Mit den Jahren näherten sie
Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen kam es nicht zum völligen Bruch zwischen Vater und Sohn. Mit den Jahren näherten sie sich wieder an, und 1991 besuchten sie gemeinsam die polnischen Städte Posen und Gnesen, wo August Schneider während des Krieges
sich wieder an, und 1991 besuchten sie gemeinsam die polnischen Städte Posen und Gnesen, wo August Schneider während des Krieges Polizeidienst verrichtet hatte. Ein Jahr später verstarb der Vater in Rötz in der Oberpfalz, wo er nach der Ruhestandsversetzung mit seiner
Polizeidienst verrichtet hatte. Ein Jahr später verstarb der Vater in Rötz in der Oberpfalz, wo er nach der Ruhestandsversetzung mit seiner Ehefrau gelebt hatte.
Für den Sohn war der Tod des Vaters nun aber nicht etwa der Schlusspunkt der Diskussionen, sondern vielmehr Ausgangspunkt umfangreicher
Ehefrau gelebt hatte.
Für den Sohn war der Tod des Vaters nun aber nicht etwa der Schlusspunkt der Diskussionen, sondern vielmehr Ausgangspunkt umfangreicher Recherchen zum dienstlichen Leben des Vaters während des Krieges. Er suchte zahlreiche Archive in Deutschland, Polen und Slowenien auf: „Es
Recherchen zum dienstlichen Leben des Vaters während des Krieges. Er suchte zahlreiche Archive in Deutschland, Polen und Slowenien auf: „Es war wie kriminalistische Kleinarbeit, die mich von Archiv zu Archiv, von Hinweis zu Hinweis, zu Kombinationen in eine Welt führte, über der ein
war wie kriminalistische Kleinarbeit, die mich von Archiv zu Archiv, von Hinweis zu Hinweis, zu Kombinationen in eine Welt führte, über der ein bleierner Mantel des Schweigens, des Rechtfertigens und der Scham lag.“ Er hatte zwar keinen konkreten Verdacht, aber doch die Befürchtung,
bleierner Mantel des Schweigens, des Rechtfertigens und der Scham lag.“ Er hatte zwar keinen konkreten Verdacht, aber doch die Befürchtung, dass der Vater an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein könnte. Denn dieser war ja an Orten gewesen, an denen Polizeieinheiten
dass der Vater an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein könnte. Denn dieser war ja an Orten gewesen, an denen Polizeieinheiten systematisch Massenverbrechen begangen hatten, in Polen, in der Ukraine, in Jugoslawien. „Er hat gesehen, was geschah, und er wusste, dass es
systematisch Massenverbrechen begangen hatten, in Polen, in der Ukraine, in Jugoslawien. „Er hat gesehen, was geschah, und er wusste, dass es falsch war.“
Die Ergebnisse der Recherchen Manfred Schneiders sollen hier nicht vorweggenommen werden. Abschließend schreibt der Autor in dem sehr
falsch war.“
Die Ergebnisse der Recherchen Manfred Schneiders sollen hier nicht vorweggenommen werden. Abschließend schreibt der Autor in dem sehr lesenswerten Buch: „Ich habe mich nicht bemüht, allgemeinverbindlich objektiv zu sein. Ich habe das, was ich fand, nach meiner
lesenswerten Buch: „Ich habe mich nicht bemüht, allgemeinverbindlich objektiv zu sein. Ich habe das, was ich fand, nach meiner Lebenserfahrung, nach meiner Durchdringung vor meinem Hintergrund, meiner Bildung verarbeitet und bewertet. … Ich glaube, wir müssen
Lebenserfahrung, nach meiner Durchdringung vor meinem Hintergrund, meiner Bildung verarbeitet und bewertet. … Ich glaube, wir müssen unseren Kindern sagen, wer wir sind und woher wir kommen.“
unseren Kindern sagen, wer wir sind und woher wir kommen.“ Manfred Schneider
August Schneider. Polizist im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945
Berlin 2021
Paperback
398 Seiten
19,26 Euro
ISBN 979-8-7001-7186-1
Über den Autor
Manfred Schneider
August Schneider. Polizist im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945
Berlin 2021
Paperback
398 Seiten
19,26 Euro
ISBN 979-8-7001-7186-1
Über den Autor Manfred Schneider wurde 1948 in Rötz /Opf. in Bayern geboren und wuchs ab 1950 im Saarland auf. Er erlernte in Lebach (Landkreis
Manfred Schneider wurde 1948 in Rötz /Opf. in Bayern geboren und wuchs ab 1950 im Saarland auf. Er erlernte in Lebach (Landkreis  Saarlouis) den Beruf des Autoschlossers, studierte von 1971 bis 1974 Sozialarbeit in Berlin und war in der Zeit von 1974 bis 1985 in der
Saarlouis) den Beruf des Autoschlossers, studierte von 1971 bis 1974 Sozialarbeit in Berlin und war in der Zeit von 1974 bis 1985 in der Planungsgruppe der Berliner Senatsverwaltung für Familie, Jugend und Sport tätig. 1985 machte er sich selbstständig und gründete mit
Planungsgruppe der Berliner Senatsverwaltung für Familie, Jugend und Sport tätig. 1985 machte er sich selbstständig und gründete mit anderen ein Beratungsunternehmen für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in dem er immer noch aktiv ist, auch nach seinem Eintritt in den
anderen ein Beratungsunternehmen für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, in dem er immer noch aktiv ist, auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand.
Als heranwachsender Jugendlicher hat ihn mehr und mehr die Frage bewegt, welche Rolle sein Vater, der während des Zweiten Weltkrieges als
Ruhestand.
Als heranwachsender Jugendlicher hat ihn mehr und mehr die Frage bewegt, welche Rolle sein Vater, der während des Zweiten Weltkrieges als Polizist an verschiedenen Schauplätzen eingesetzt war, tatsächlich gespielt hat. Tat er dort seinen Dienst nur als Ordnungspolizist oder hatte
Polizist an verschiedenen Schauplätzen eingesetzt war, tatsächlich gespielt hat. Tat er dort seinen Dienst nur als Ordnungspolizist oder hatte er weiterreichende Aufgaben? War er gar an Kriegsverbrechen beteiligt? Antworten auf solche Fragen bekam er von seinem Vater nicht. Der
er weiterreichende Aufgaben? War er gar an Kriegsverbrechen beteiligt? Antworten auf solche Fragen bekam er von seinem Vater nicht. Der aber war dort, wo von der Polizei systematisch Gräueltaten verübt worden waren, nämlich in Polen, in der Ukraine und in Jugoslawien. Es war
aber war dort, wo von der Polizei systematisch Gräueltaten verübt worden waren, nämlich in Polen, in der Ukraine und in Jugoslawien. Es war damals die Zeit, über der ein bleierner Mantel des Schweigens, Verdrängens, Rechtfertigens und der Scham lag. Manfred Schneider wollte
damals die Zeit, über der ein bleierner Mantel des Schweigens, Verdrängens, Rechtfertigens und der Scham lag. Manfred Schneider wollte sich damit nicht zufrieden geben. So begann für ihn – neben seiner Berufstätigkeit – eine lange Zeit des Suchens und Nachforschens.
sich damit nicht zufrieden geben. So begann für ihn – neben seiner Berufstätigkeit – eine lange Zeit des Suchens und Nachforschens. Diesem Buch liegt eine jahrzehntelange akribische Recherche in nationalen und internationalen Archiven zugrunde, während derer der
Diesem Buch liegt eine jahrzehntelange akribische Recherche in nationalen und internationalen Archiven zugrunde, während derer der  Autor eine Vielzahl von Originaldokumenten ausfindig machen, sichten und auswerten konnte. Bei seinen Sucharbeiten fand er in den
Autor eine Vielzahl von Originaldokumenten ausfindig machen, sichten und auswerten konnte. Bei seinen Sucharbeiten fand er in den jeweiligen ArchivInstitutionen wertvolle Hilfestellungen
jeweiligen ArchivInstitutionen wertvolle Hilfestellungen

